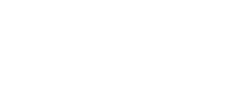Hintergrund: Regulatorik
Rückblick: Bankenregulierung damals….
1988 wurde das erste global gültige Regulierungsrahmenwerk (Basel I) vorgestellt – eine Zäsur zu der bis dahin rein national geprägten bankaufsichtlichen Denkweise. Anlass für diese weltweite Regelung war die Sorge der Notenbankgouverneure der wichtigsten Industriestaaten über die sehr niedrige Kapitalausstattung der Kreditinstitute. Bis zu dem damaligen Zeitpunkt hatten in Deutschland das Kreditwesengesetz (KWG) und dessen Auslegung durch das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen (BaKred, heute BaFin) den Finanzmarkt geprägt. Mit der Vorgabe einer Mindesteigenkapitalquote (Solvabilitätskoeffizient) erfuhren die Institute eine Beschränkung der Kreditvergabemöglichkeiten in Abhängigkeit von ihrer jeweiligen Kapitalstärke.
Die zunehmende Technisierung des Bankbetriebs hat in den darauffolgenden Jahren die Zahl der Finanztransaktionen an nahezu allen Weltmärkten stark erhöht. Die Volumina und die Handelsgeschwindigkeit stiegen rasant und und mit ihnen die Kritik an der nicht ausreichend risikosensitiven Ausgestaltung der Eigenkapitalquote.
Die Aufsichtsbehörden waren gezwungen, den Regulierungsrahmen zu überarbeiten und Anreize für die Verwendung von fortschrittlichen Ansätzen zur Risikomessung für einzelne Anlageklassen einzuführen (Basel II). Das neue Regelwerk führte im Jahr 2004 einzelne Themenbereiche des Risikomanagements viel detaillierter aus, neben quantitativen und qualitativen Vorgaben wurde erstmals auch eine Pflicht zur Offenlegung von Informationen festgeschrieben. In Deutschland wurden die Regelungen durch die erstmals 2005 veröffentlichten Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ergänzt. Die zunehmende Detailtiefe von Basel II gegenüber dem Vorgängerpapier lässt sich bereits an der Seitenzahl erkennen: während Basel I mit 35 Seiten auskam, wurde Basel II bereits 284 Seiten stark.
Die Turbulenzen an den Finanzmärkten und ihre Auswirkungen auf die Realwirtschaft haben dann im Jahr 2010 eine erneute und umfassende Revision des Baseler Rahmenwerks nötig gemacht (Basel III). Das Empfehlungspapier hat die Europäische Union 2013 in zwei separaten Veröffentlichungen umgesetzt - auf insgesamt 1687 Seiten. Entstanden sind die Verordnung „Capital Requirements Regulation“ (CRR) und die Richtlinie „Capital Requirements Directive“
(CRD IV). Flankiert durch nationale Gesetzesänderungen
(CRD IV-Umsetzungsgesetz) und zahlreiche Auslegungspapiere zu einzelnen Themenbereichen ist der neue Regulierungsrahmen Anfang 2014 in Kraft getreten.
…und heute
Basel, Brüssel, London, Berlin und Saarbrücken sind Orte, die stellvertretend für die Institutionen stehen, die in unterschiedlicher Ausprägung an der Gestaltung der bankaufsichtsrechtlichen Vorgaben beteiligt sind. Diesem vielstimmigen Chor steht nicht etwa ein einzelner Leiter vor, sondern die Vielzahl der beteiligten Dirigenten in diesem Spiel legen konsensfähige Regeln fest, zu deren Einhaltung sich die Marktteilnehmer später selbst verpflichten.
Angeführt wird das Regelkonsortium von den Notenbankchefs der G 20-Staaten, Tagungsort ist die Bank für internationalen Zahlungsausgleich (BiZ) mit Sitz in Basel. Daher kommt auch der Name für das aufsichtsrechtliche Rahmenwerk. Brüssel als administrative Hauptstadt der Europäischen Union ist verantwortlich für die Umsetzung der Vorgaben in europäische Richtlinien und Verordnungen.
Die detaillierte Ausgestaltung der technischen Standards wiederum übernimmt die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (European Banking Authority, EBA) mit Sitz in London. Die Interessen der deutschen Finanzwirtschaft werden dabei zentral vertreten durch die Deutsche Kreditwirtschaft (DK).
Ihr gehören die Dachverbände der einzelnen Bankengruppen an. Ihre Führung wechselt regelmäßig und obliegt immer wiederkehrend auch dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) in Berlin.
Träger des DSGV sind die Regionalverbände und Landesbanken, so auch der Sparkassenverband Saar in Saarbrücken. Er steht der regionalen Vertretung im Finanzausschuss der Bundesländer beratend zur Seite.
Regulierungen aktiv mitgestalten
Die Vielfalt der einzelnen Institute und die Stärke als Gruppe nutzen die Sparkassen, um die großen Herausforderungen aktiv zu gestalten. Erfahrungen und Expertise werden auf europäischer und nationaler Ebene eingebracht, damit in den Gesetzen und Verordnungen auch weiterhin die Strukturen und Werte der deutschen Sparkassen berücksichtigt werden. Die Repräsentanzen in Berlin und Brüssel sind dabei wichtige Schnittstellen zu den jeweiligen Entscheidungsträgern.